Die Vereine des Freiburger Kreises mit ihren derzeit mehr als 900.000 Mitgliedern haben seit mehr als zwei Jahren allen Schwierigkeiten der Corona Pandemie getrotzt und in ihren Quartieren mit viel Engagement das angeboten, was ihnen die jeweiligen Eindämmungs-Verordnungen nicht untersagt haben. Sie waren für ihre Mitglieder da und haben zahlreiche neue Angebote, u.a. auch im digitalen Bereich, aufgenommen.
Trotzdem mussten sie in der Pandemie seit März 2020 bis heute einen durchschnittlichen Mitglie-derrückgang von über 10 % verzeichnen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und seit Februar 2022 kommen weitere Herausforderungen auf die großen Sportvereine zu. Durch den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine sind Millionen von Menschen auf der Flucht. Die Mitgliedsvereine des Freiburger Kreises reagieren unbürokratisch und schnell und heißen die Menschen aus der Ukraine willkommen, bieten größtenteils eine kostenfreie Teilnahme an den Sportangeboten an und richten hierfür auch neue Übungsgruppen ein. Des Weiteren gibt es unzählige individuelle Unterstützungsangebote durch die Mitglieder der Freiburger Kreis-Vereine.
Die Freiburger Kreis-Vereine besitzen und bewirtschaften fast alle eigene Sportstätten. Die explodierenden Kosten im Energiesektor treffen gerade diese Sportvereine besonders stark. Ohne finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand, werden die Vereine diese Kosten nicht tragen können, wenn gleichzeitig die breit gefächerte Angebotspalette nicht reduziert werden soll.
Gerade im Breitensport, welcher in unseren Vereinen im Vordergrund steht, werden elementare Werte unserer Gesellschaft gelebt. Hierzu gehören u.a. Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit, Respekt, Toleranz, Fairness, Solidarität, Teamgeist und Disziplin. Aber auch die Einhaltung von Regeln in einer gewaltfreien Sportausübung trägt zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen bei. Hinzu kommen die gesundheitlichen Aspekte von Sport und Bewegung, deren Stellenwert gerade in den letzten Jahren durch die voranschreitende Digitalisierung und Technisierung an Bedeutung gewinnt.
Aus diesem Grunde fordern die Sportvereine des Freiburger Kreises,
• dass Förderprogramme des Bundes für die Sportinfrastruktur grundsätzlich auch für Sportvereine geöffnet werden.
• dass die Unterstützung von Sport und Bewegung im Breitensport auch als Aufgabe des Bundes gesehen wird und hierfür ggfs. auch das Grundgesetz geändert wird, damit der Bund nicht nur den Spitzensport fördert.
• dass der Breitensport mit all seinen positiven Auswirkungen von Sport und Bewegung auf die Gesellschaft als Querschnittsaufgabe über alle Ministerien verstanden wird und für die Umsetzung im Bundeskanzleramt die Stelle einer Staatsministerin bzw. eines Staatsministers geschaffen wird.
• dass die explodierenden Kosten im Energiesektor durch Unterstützungsprogramme des Bundes für die energetische Sanierung von vereinseigenen Sportstätten abgefedert werden.
• dass die qualifizierte Anleitung von ausgebildetem Personal durch eine signifikante Anhebung der staatlichen Übungsleiterzuschüsse aus Bundeszuschüssen stärker als bisher finanziell unterstützt werden.
Wir sprechen uns zudem mit Nachdruck für ein verpflichtendes soziales Jahr nach Beendigung der Schulzeit aus, damit jungen Menschen auch im Sportverein eine berufliche Perspektive aufgezeigt werden kann.
Die „Hamburger Erklärung“ der im April stattgefundenen außerordentlichen Sportministerkonferenz macht deutlich, dass die Bundesländer dem Bund einen Schritt voraus sind, in dem sie für den Sport folgendes formulierte:
„Bei der Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen ist Sport längst zu einem unverzichtbaren Faktor mit hohem politischen Stellenwert geworden. Denn Sport fördert nicht nur individuelle Lebensqualität und Gesundheit, sondern auch Zusammenhalt und Respekt und stärkt die Abwehrkräfte der Gesellschaft gegen soziale Destabilisierung, Polarisierung, Menschenfeindlichkeit und Demokratieverachtung.“
Der angesichts vielfältiger Krisen (Klima, Gesundheit, Kriege, Fluchtbewegungen, Demografie etc.) wachsende Stellenwert des (Breiten-)sports muss sich auch in einem Paradigmenwechsel der Sportpolitik des Bundes widerspiegeln. Der Leistungssport kann nicht ihr einziger Fixpunkt sein. Der gesamte Sport muss im Fokus der Bundespolitik und Bundesförderung stehen.
Wir unterstützten in diesem Zusammenhang den Appell des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Deutschen Sportjugend (dsj) an die Bundesregierung, einen Bewegungsgipfel einzuberufen, bei dem viele Bundesministerien an einem Tisch sitzen. Denn wir können Herausforderungen wirkungsvoller gemeinsam angehen, wenn man einen Blick aus verschiedenen Politikfeldern auf eine Gesamtstrategie und ein Bewegungsbündnis hat.
In diesem Sinne fordern wir den Bund auf, die sportpolitische Zeitenwende mitzugehen.
Verabschiedet von den Mitgliedsvereinen des Freiburger Kreises
Am 28.10.2020 erließen die Bundesregierung und Landesregierungen Maßnahmen zur Reduzierung der Inzidenzzahlen des COVID-19-Virus. Wieder sind die Breitensportvereine in aller Härte durch den Teil-Lockdown be-troffen. Deshalb appelliert der Freiburger Kreis an die verantwortlichen Politiker*innen, die besondere Situation der großen Breitensportvereine zu bedenken.
1.) Einbeziehung der besonderen finanziellen Systematik der Breitensportvereine in die Hilfen
Während unter anderem in der Gastronomie und in der Eventbranche Insolvenzen oder drohende Insolvenzen absehbar sind, gleicht die Entwicklung im Breitensport einem langsamen Ausbluten. Viele Vereine können noch nicht von der Sonderhilfe profitieren, weil aktuell (noch) keine Existenzgefährdung vorliegt. Große Breitensport-vereine verlieren seit November massiv Mitglieder. Bei einem prognostizierten Mitgliederverlust von 10% für das nächste Jahr hätten die einzelnen Vereine des Freiburger Kreises Einbußen im 6-stelligen Bereich hinzunehmen – allein bei den Mitgliedsbeiträgen. Dagegen bleibt ein Großteil der Kosten bestehen, weil die meist sehr umfangreichen vereinseigenen Sportanlagen weiterhin zu betreiben sind und die einzelnen Angebote auf Grund der Hygienekonzepte sowieso mit weniger Teilnehmer*innen ablaufen müssen. Hier sind besonders die Groß-vereine mit vereinseigenen Anlagen und festangestellten Mitarbeiter*innen betroffen. Der Fortbestand der durch innovative Sportvereine über Jahrzehnte aufgebauten Strukturen ist dadurch gefährdet.
Der Freiburger Kreis richtet deshalb an die politisch Verantwortlichen den Appell, kurzfristige Nothilfen in langfristige Zuschüsse (bis mind. 2023) umzuwandeln – z.B. über den Hebel der Übungsleiter/innen-Zuschüsse.
2.) Wiederöffnung des Breitensports, insbesondere für Kinder und Jugendliche so früh wie möglich!
Der gesundheitliche Wert regelmäßigen Sporttreibens ist unbestritten. Auf diese Tatsache weist auch das ge-meinsame Positionspapier der Landessportbünde und des DOSB hin. Viele Vereine mit eigenen Anlagen erleben gerade die Situation, dass am Vormittag Schulklassen die Sportstätten bevölkern, Kinder und Jugendliche aber nicht in die Sportstunden des Vereins kommen dürfen. In den vergangenen sechs Monaten der Pandemie entwickelten die Breitensportvereine griffige Hygienekonzepte sowohl für ihre eigenen wie auch die angemieteten Sportstätten. Da im Sport Disziplin stets eine große Rolle spielt, fällt es den Vereinen nicht schwer, die Umsetzung der Konzepte durchzusetzen. Die Sportler*innen, auch die Kinder und Jugendlichen, haben sich inzwischen an die lokalen Hygienekonzepte gewöhnt. Außerdem war die Nachverfolgbarkeit stets gegeben, falls ein positi-ves Testergebnis vorlag.
Der Freiburger Kreis appelliert an die Politik, den Breitensport für Kinder und Jugendliche so früh wie möglich wieder zu öffnen.
Der Freiburger Kreis versteht nicht, dass der Sport für Erwachsene umfassend und flächendeckend geschlossen wurde, auch für Bereiche, in denen die AHA+L-Regeln gut eingehalten werden können. Selbstverständlich ver-treten die FK-Vereine gegenüber ihren Mitgliedern die Beschlüsse der kommunalen und staatlichen Behörden, wenn ein dramatisches lokales Infektionsgeschehen massive Kontakteinschränkungen erforderlich macht.
2
3.) Mehr Forschung über die Infektionswege, speziell beim gemeinsamen Sporttreiben
Die Verantwortlichen der Freiburger Kreis-Vereine stellten während der zurückliegenden Öffnung erstaunlich wenige Infektionen im Sport selbst fest, auch wenn Vereinsmitglieder eine positive Testung meldeten und da-nach über die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung initiiert wurde. Sie sind überzeugt davon, dass sich die Sportler*innen an die eingeführten AHA+L-Regeln der Vereine hielten und halten werden. Gerade diese kontrollierten Bereiche zu schließen und das Sporttreiben in den privaten Bereich zu verlagern, könnte sich kontraproduktiv auswirken. Während in die Forschung für Medikamente und Impfstoffe Milliarden investiert werden, ist die Ungewissheit, wo und wie Infektionsketten entstehen, immer noch sehr groß; denn dazu liegen nicht ge-nügend wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Diese Erkenntnisse sind allerdings für eine langfristige Akzeptanz für die jeweiligen Corona-Schutzmaßnahmen fundamental wichtig. Im Zuge einer Wiedereröffnung regt der Freiburger Kreis daher an, in ausgesuchten Vereinen Studien vornehmen zu lassen, mit denen untersucht wird, wie hoch das Ansteckungsrisiko beim Sporttreiben überhaupt ist bzw. in welchem Maße und mit welchen Maßnah-men sich das Virus beim gemeinsamen Sporttreiben eindämmen lässt.
Den „Wert des Sports“ kann man kaum besser zusammenfassen, als dies Rainer Maria Kardinal
Woelki mit seiner Kölner Sportrede 2018 getan hat.
Getrost darf man von ihm genannte Aspekte wie die gesundheitsfördernde Wirkung, die gesellschaftsintegrativen Kräfte sowie die geselligen Varianten auf der Habenseite des Breitensports verbuchen. Sieht man sich die Leitbilder der großen Breitensportvereine an, sind darin genau diese Werte verankert. Die von Kardinal Woelki aufgezeigte janusköpfige Seite des Sports kommt im Breitensport nicht zum Vorschein; Doping, ausufernder Kommerz, Ruhm um jeden Preis oder Missbrauch durch Ideologien spielt in Breitenspotvereinen kaum eine Rolle.
Natürlich kann Breitensport auch in anderen Ländern ausgeübt werden, ohne dass es dort Vereinsstrukturen wie in Deutschland gibt. Allerdings tut die deutsche Gesellschaft gut daran, ihre Vereinsstrukturen zu pflegen. Denn ohne das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen könnte diese „wert“-volle Arbeit in der Fläche nicht mehr bezahlt werden und würde zum Luxusgut. Wollen wir das?
Außerdem können große Sportvereine nur mit einem attraktiven Breitensportangebot leistungsnahen Wettkampfsport querfinanzieren. Daraus entwickeln sich Talente, die dann später mit Programmen wie „Go for Gold“ Olympiasieger oder Weltmeister werden könnten.
Für die Verbände bleibt die Frage, welche Modelle sie strukturell fördern sollen und welche Kooperationen sie in Zukunft unterstützen. Dazu einige Beispiele:
Die Zukunft der großen Breitensportvereine ist abhängig von der strategischen Antwort der Verbände, ob diese die Vereine in ihrer Arbeit eher fördern oder behindern. Diese Antwort wird bestimmen, inwieweit Vereine noch die Belastungen des leistungsnahen Wettkampfsports schultern können. Diese Antwort wird bestimmen, ob unsere Gesellschaft gesünder altert. Diese Antwort wird bestimmen, wie die Vereine Spaß durch Sport vermitteln können. Diese Antwort wird bestimmen, ob der Sport weiterhin seine hohe integrative Wirkung für die Gesellschaft entfalten kann. Dessen müssen sich Verbände bewusst sein.
Wie sagte Kardinal Woelki: „Zwischen ‚gar keinen Sport betreiben‘ und ‚Leistungssport‘ liegen Welten. Die Welt des Sports hat viele Facetten und Dimensionen.“ In dieser Welt des Sports erfüllen die Breitensportvereine ihre wertvolle Aufgabe.
Sport ist in der heutigen Gesellschaft zu einem wichtiger Beitrag zur Steigerung des Wohlbefindens der Bürger und damit zu einer wesentlichen Größe der Entwicklung der Kommune geworden. Die Vereine des Freiburger Kreises tragen maßgeblich zur Realisierung (strategischer) kommunalpolitischer Ziele bei. Dies gilt insbesondere für die Förderung von:
Vereine des Freiburger Kreises bieten mit ihren Organisations-, Kommunikations- und Managementstrukturen unter Kosten- und Wirksamkeitsgesichtspunkten günstige Voraussetzungen für eine effiziente Verwirklichung der Ziele. Die zukunftsorientierte, erfolgreiche Bearbeitung der komplexen Handlungsfelder und die gemeinsame Bewältigung der Querschnittsaufgaben verlangt nach einer Kooperation der betroffenen Akteure.
Um einen möglichst wirkungsvollen Beitrag zur Realisierung der Ziele leisten zu können, ist es notwendig, dass
Dabei steht außer Frage, dass die jeweiligen Zuständigkeiten der Partner anerkannt werden. Vertrauensbildung stellt sich für alle Beteiligten als Daueraufgabe.
Die Zahl von 53 Vorschlägen, Planungen und Zeitangaben ohne Einordnung in einen mittel- bzw. langfristigen Zeitplan verdeutlicht die Notwendigkeit, Entscheidungen zu Prioritäten zu fällen.
Hierbei müssen folgende Kriterien ausschlaggebend sein:
Hinsichtlich mancher geplanten Aktivität ist die Bedarfsfrage kritisch zu stellen. So ist z.B. nicht erkennbar, warum „neue Leitlinien für körperliche Aktivität“ entwickelt werden sollen, wenn schon die Charta „Sport für Alle“ und der Ethik-Codex des Europarats eindeutige Aussagen enthalten. Ähnliches gilt für die eine oder andere geplante Studie, z.B. über ehrenamtliche Tätigkeit im Sport, in Forschungsfeldern, in denen bereits umfassende Untersuchungen vorliegen.
Eine enge Zusammenarbeit mit Sportorganisationen ist geplant und erforderlich. Sie sollte in der Tagesarbeit jedoch systematisch aufeuropäischeOrganisationen ausgerichtet sein. Um den Belangen von Sportinstitutionen anderer politischer Ebenen Gehör zu verschaffen, sollte ein repräsentativ besetztes Forum geschaffen werden.
Dringend erforderlich ist die konsequente Einbeziehung des Sports in alle hierfür geeigneten Aktions- und Förderprogramme. Hierbei muss einer Generaldirektion eine kontrollierende und koordinierende Funktion zuerkannt werden. Sie muss zugleich für die entsprechende Kommunikation mit den Sportorganisationen verantwortlich sein.
Spezifische Sportförderprogramme sollen sich eindeutig auf supranationale Maßnahmen beziehen und zugleich beschränken. Es kann nicht Aufgabe der Europäischen Kommission sein, lokale und regionale Aktivitäten einzelner Schulen, Vereine oder Landesverbände finanziell zu fördern oder – wie vorgeschlagen – mit einem „europäischen Siegel“ auszuzeichnen.
Die Europäische Kommission sollte sich nicht den Auftrag stellen, den „Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und den Sportverbänden organisieren“ zu wollen. Sie sollte jedoch eine Aufgabe darin sehen, vorliegende herausragende Modelle einer zielorientierten Sportentwicklung bekannt zu machen.
Bei Maßnahmen der Steuerharmonisierung in der Europäischen Union muss die Begünstigung des gemeinnützigen Sports, wie im „Weißbuch“ genannt, gesichert werden. Der nicht als Beruf betriebene Sport muss als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge anerkannt bleiben.
Unsere Stellungnahme berücksichtigt nicht die vorwiegend den professionellen Sport betreffenden Aussagen des „Weißbuchs“. Die Vereine des Freiburger Kreises gehen allerdings davon aus, dass Organisationen und Institutionen jeglicher Art, die Sport zum Zweck der Gewinn-Erzielung betreiben oder anbieten, von der Förderung aus Mitteln der Europäischen Union ausgeschlossen bleiben.
Das viel beschworene „solidarische System“ des organisierten Sports in Deutschland ist historisch begründet. Es stammt aus den 50er Jahren. Ehemalige Wettkampfsportler bildeten nach Ende der Wettkampfkarriere die Passiven oder Freizeitsportler in ihren Vereinen. Sie zeichneten sich aus durch die Solidarität mit ihrer Sportart und waren deshalb bereit, einen Teil ihres Vereinsbeitrages oder ihres ehrenamtlichen Engagements auch wieder zur Verfügung zu stellen.
Allerdings haben sich in den letzten Jahrzehnten die Mitgliederstruktur der Vereine, das Sportangebot und die Motive, in einen Sportverein einzutreten, grundlegend geändert, ohne dass die Fachverbände in ihrer Gesamtheit daraus Konsequenzen gezogen haben. So wurden tausende Sportinteressierte Mitglieder in Sportvereinen, die in ihrem Leben nie Wettkampfsport betrieben haben und dies auch nie wollten. Sie sehen im Sportverein eine Möglichkeit, sich unter Anleitung sportlich zu betätigen, ohne sich einer bestimmten Sportart zuzuordnen oder am Vereinsleben zu beteiligen, die somit keine Solidarität zu anderen Vereinsmitgliedern und dem Verein entwickeln wollten oder konnten. Hierzu haben auch die unterschiedlichen Kampagnen des DSB beigetragen. Dass sich heutzutage die Mitglieder eines Sportvereins, insbesondere eines Vereins mit mehreren Abteilungen, sich als eine Einheit sehen, als ein solidarisches System empfinden, mag zwar wünschenswert sein, entspricht aber nicht immer der Realität. Hier haben die Vereine sicherlich etwas versäumt.
Es gehört auch zu den historischen „Altlasten“ in den Vereinen, dass der Wettkampfsport durch die Beiträge der Passiven sowie der Breiten- und Gesundheitssportler subventioniert wird. Die beschriebene, über Jahrzehnte praktizierte Subventionierung des Wettkampfsportes hat in den Vereinen dazu geführt, dass Wettkampfsportler selten „kostengerechte“ Beiträge gezahlt und diese Querförderung gern als „von Gott gegeben“ angenommen haben.
Gerade unter diesem Gesichtspunkt hat der Freiburger Kreis zu Beginn seines Seminars in Rheine im September 2007 die Frage „Solidarität oder Verursacherprinzip“ für die Vereine zur Diskussion gestellt.
Die Organisation und Durchführung sowie das Erstellen von „neuen Produkten“ im Breiten- und Gesundheitssport verlangt von den Vereinen immer höhere Anstrengungen (entsprechende Sportstätten, qualifiziertes Personal, höherer Managementaufwand). In den Vereinen werden aus Ideen Trends und diese werden unter großem Aufwand als Sportarten in den Vereinen etabliert. Die Vereine schaffen dafür Rahmenbedingungen durch entsprechende Sportstätten und qualifiziertes Personal, meist ohne Hilfe ihrer (Fach)-Verbände. Insbesondere die Ausbildung unserer Kinder in den Abteilungen und Kindersportschulen erfordert ein hoch qualifiziertes Personal. Mit einem Teil dieser Beiträge den finanziell schwächeren Vereinsmitgliedern die gleichen Chancen zu gewähren, Sport im Verein zu treiben, ist praktizierte Solidarität, den Wettkampfsport aber damit zu subventionieren kann keinen Sinn ergeben. Es ist deshalb kaum denkbar, dies als zusätzlichen Solidarbeitrag einzufordern.
Während sich die Verbände mit der Frage der möglichen konzeptionellen und fachlichen Einbindung in die Solidargemeinschaft Sport auseinandersetzen, wird die Sportart in den Vereinen weiter entwickelt, um sich gegenüber anderen Sportanbietern durchsetzen zu können. Dafür sind häufig ein sehr hoher Managementaufwand und ein an den beschriebenen Bedürfnissen häufig deutlich höherer Beitrag nötig.
Der Leistungssport wird immer teuerer. Er lässt sich von fast allen Vereinen kaum noch finanzieren. Auch wenn Sportpolitiker das „Solidarprinzip im Verein“ fordern, ist dies allerdings eine Richtungsentscheidung, die die Vereinsgemeinschaft selbst zu treffen hat. Dabei muss grundsätzlich gelten, dass Solidarität nicht verordnet werden kann.
Im Verein haben die Mitglieder die Möglichkeit, den Verein zu verlassen, wenn ihnen das Prinzip der Solidarität zu weit geht. Vereine als Mitglieder eines Sportverbandes haben fast keine Möglichkeiten, die Fachverbände zu verlassen. Sie müssen bei dem heutigen System das „Schlupfloch“ der Mitgliedermeldung nutzen, wenn sie eine Finanzierung nach dem Solidaritätsprinzip ihren Mitgliedern gegenüber nicht mehr rechtfertigen können.
Das Solidarprinzip wird in der Sportbewegung derzeit nur dann bemüht, wenn es darum geht, Mittel für die Subventionierung des Leistungssportes zu gewinnen.Solidarität bedeutet jedoch, dass Derjenige, der hat, Demjenigen etwas abgibt, der der Hilfe bedarf. Angesichts guter „Verdienste“ für Trainer und Sportler in manchen Sportarten ist danach zu fragen, ob eine Subventionierung des Breitensportes durch den Leistungssport in vielen Fällen nicht auch seine Berechtigung hätte. Dass Ähnliches passiert, ist allerdings nicht feststellbar.
Grundsätzliche Aussagen:
Die Vereine erwarten ein einfaches unbürokratisches Meldewesen:
Die Freiburger Kreis-Vereine bekennen sich in ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur Talentsuche und Talentförderung im Sport.
Der Freiburger Kreis unterstützt das „Nachwuchsleistungssportkonzept“ des Deutschen Sportbundes und begrüßt die Aussage: …„Die Verantwortung liegt in erster Linie bei den Sportvereinen, die dafür entsprechend zu unterstützen sind,und dem Schulsport.“ …
Die den Vereinen gewährte Unterstützung in finanzieller, konzeptioneller, materieller und personeller Hinsicht reicht allerdings zur Optimierung der bisher erreichten Standards nicht aus.
Für die meisten Sportarten sollte es im Verein keine zu frühe Trennung von Breiten- und Leistungssport geben. Gerade auch mit dem Blick auf die demografische Entwicklung mit immer kleiner gewordenen Kinder- und Jugend-Jahrgängen muss verhindert werden, dass die Konkurrenz zwischen den Sportverbänden zu Fehlentwicklungen führt. Vielmehr muss weiterhin gelten, dass eine sportartübergreifende Ausbildung, nicht aber eine frühe Spezialisierung den richtigen Weg darstellt, um die motorischen Grundeigenschaften und Grundfertigkeiten auszubilden.
Deutliche Verbesserungen müssen in der Begleitung junger Talente (Schule, Beruf, soziale Entwicklung, Physiotherapie u. ä.) erfolgen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass z. Zt. ein verlässliches Begleitsystem für die Entwicklung junger Menschen aus dem Wettkampfsport zum Leistungssport nur an wenigen Stützpunkten vorhanden ist. Umso wichtiger ist es, die Verbindung des jungen Athleten mit dem Verein möglichst eng zu bewahren.
Eine breite Zusammenarbeit in vereinsinternen und -externen Netzwerken unter Beteiligung der Fachverbände ist Voraussetzung für eine effiziente Talentförderung. Insbesondere herausragende regionale Sportstätteninfrastrukturen müssen vereinsübergreifend nutzbar sein, ohne dass hiermit Vereinswechsel erzwungen werden.
Wir halten es für erforderlich, dass die Erfahrungen der Vereine bei der Erarbeitung von Konzeptionen durchgehend stärker berücksichtigt werden und dass das Nachwuchsleistungssportkonzept nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben gestaltet wird.
Die Freiburger Kreis-Vereine bieten hierzu ihre Fähigkeiten und Erfahrungen an:
Die qualitative Steigerung der Talentförderung erfordert eine größere Finanzkraft und vermehrte Ressourcen, aber auch eine intelligentere Nutzung von vorhandenen Ressourcen über Netzwerke.
Die Vereine des Freiburger Kreises finanzieren die hohen Kosten anspruchsgerechter Talentförderungsmaßnahmen weitestgehend aus dem allgemeinen Beitragsaufkommen, doch diese Form stößt an ihre Grenzen. Deshalb müssen weitere Ressourcen erschlossen werden. Hierzu gehört auch die zu verbessernde Nutzung von Netzwerk-Möglichkeiten.
Der Sport in den Vereinen entscheidet darüber, ob unsere Talente entdeckt und so gefördert werden, dass diese später im internationalen Leistungsvergleich bestehen können.
Wir Freiburger Kreis-Vereine sind starke Partner im Sport vor Ort.
Verabschiedet beim Frühjahrsseminar in Göttingen am 13. Mai 2006







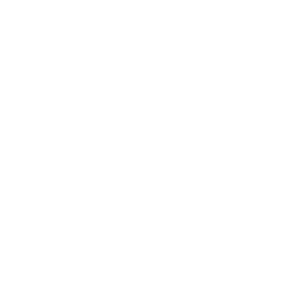
Unser Netzwerk bietet seinen Mitgliedern eine Vielfalt von Möglichkeiten,
den eigenen Verein weiterzuentwickeln.
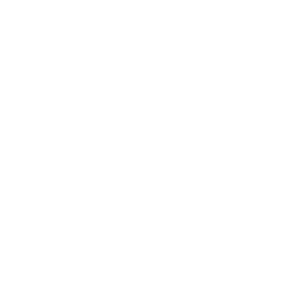
Unser Netzwerk bietet seinen Mitgliedern eine Vielfalt von Möglichkeiten,
den eigenen Verein weiterzuentwickeln.